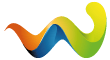Das Film- und Kinojahr 2016 war mal wieder geprägt von Hochs und Tiefs, von Independent-Werken und Blockbuster-Bomben, von Faszination, Unterhaltung, Mittelmass, Langweile und Schrott und nicht zuletzt von der Erkenntnis, dass ich meine Faszination für Superheldenmythen am besten befriedige indem ich auf die Comics umsteige. Dieses Jahr war ich wohl häufiger im Kino als zuvor in meinem gesamten Leben. „Wieso?“, höre ich manche fragen. „Wieso nicht?“, sage ich.
Nocturnal Animals (Tom Ford) – 10 / 10
Zynisch, verstörend, doppeldeutig, hintersinnig, komplex, brutal, ästhetisch, elegant, aggressiv, zärtlich, böse und für mich schlicht der eindeutig beste Film des Jahres.
The Revenant (Alejandro González Iñárritu) – 9,5 / 10
Vielschichtiges Meisterstück, dessen präziser und kunstvoller Bildersog einen regelrecht in diese längst vergangene Epoche hineinreisst. Iñárritu erschafft aus der simplen Menschenhatz in den nordamerikanischen Wäldern kurzerhand eine ganz eigene Welt, und die filmischen Mittel mit denen er dies vollbringt faszinieren bis zuletzt.
Arrival (Denis Villeneuve) – 9 / 10
Villeneuve kann also auch Science-Fiction und bestätigt sich damit als einer der interessantesten Regisseure derzeit. Psychedelisches, spannendes und geistreiches Kino, das sich erfrischend anders mit der Materie auseinandersetzt als viele thematisch verwandte Filme.
Un + Une (Claude Lelouch) – 9 / 10
Zwei Landsleute auf einer geheimnisvollen Reise durch Indien. Feinfühlig inszeniert, bärenstark gespielt und mit viel Gespür für die Charaktere erzählt. Ganz grosses Dramakino.
Our Kind of Traitor (Susanna White) – 9 / 10
Die neue John le Carré Verfilmung steht der letzten in nichts nach. Spannend, fesselnd, einfühlsam und phänomenal gespielt von Skarsgård und McGregor.
Hell or High Water (David Mackenzie) – 8,5 / 10
Melancholisch aber humorvoll, ein fast schon meditatives Action-Roadmovie quer durchs ländliche Texas. Toll gespielt und toll inszeniert, von dieser Sorte braucht es mehr im Kino.
Julieta (Pedro Almodóvar) – 8,5 / 10
Wunderbare Lebens- und Charakterstudie, charmant inszeniert und mit viel Gefühl für die Schwächen der Protagonisten erzählt. Dazu tolle Musik.
Café Society (Woody Allen) – 8 / 10
Auf Woody ist Verlass, auch sein diesjähriger Output bietet wieder geistreiches Kino mit Witz und Charme in edlen Bildern. Weiter so, Woody.
Eddie the Eagle (Dexter Fletcher) – 8 / 10
Anrührendes Underdog-Sportdrama mit zwei ausgezeichnet miteinander harmonierenden Hauptdarstellern und genau der richtigen Prise gut gemachtem Kitsch.
The Nice Guys (Shane Black) – 8 / 10
Schwarzer Humor, clevere Sticheleien gegen das Buddy- und Thrillergenre, eine Prise Hommage und ein absolut dynamisches Duo. Der beste Black bisher.
Captain America: Civil War (Russo Brothers) – 8 / 10
Der mit Abstand stärkste Comicfilm des Jahres dank interessant koordinierten Figuren, dynamisch reduzierten Kampfszenen und der passenden Gleichgewichtung von Stil und Substanz.
The Light Between Oceans (Derek Cianfrance) – 8 / 10
Ein gefühlsvoll inszeniertes, kraftvolles Drama mit einer sensationellen Vikander und einer überzeugenden erzählerischen Strukturierung in zwei Akten.
The Accountant (Gavin O’Connor) – 8 / 10
Ein bisschen Behindertendrama, ein bisschen Wirtschaftskrimi, ein bisschen Hardcore-Action und fertig ist der Accountant. Die Mischung funktioniert trotz oder gerade wegen ihrer Widersprüche so gut.
El Abrazo de la Serpiente (Ciro Guerra) – 8 / 10
Spirituelle Ode an Apocalypse Now, ein fast schon meditativer Trip durch die Natur des Amazonas. Bescheidene Mittel, aber viel Erzählkunst.
Hail, Caesar! (Coen Brothers) – 8 / 10
Die Coens sind wieder auf dem Komödienkurs. Tolle Gags, geistreiche 50er-Jahre-Reminisenzen und ein phänomenales Starensemble, in Summe aber auch deutlich seichter als frühere Grosstaten der Brüder.
Rogue One (Gareth Edwards) – 7,5 / 10
Wuchtige und kraftvolle Neuinterpretation des originalen Star-Wars-Mythos, die mit charmanten Reminiszenzen und mitreissenden Schlachtenszenen zu fesseln weiss, auf dem Gebiet der Figuren jedoch zu oberflächlich bleibt.
La Pazza Gioia (Paolo Virzì) – 7,5 / 10
Zwei Bekloppte fliehen aus der Anstalt und erleben das Abenteuer ihres Lebens: Exzellente Figuren, Bilder und Emotionen, lediglich im Spagat zwischen Tragik und Komik ist dieser italienische Film teils etwas ungelenk.
A Hologram for the King (Tom Tykwer) – 7,5 / 10
Kleines aber feines Drama rund um Liebe, Leben und Neuanfang mitten in der Wüste, dazu kommt ein starker Tom Hanks in der Hauptrolle.
Retour chez ma mère (Éric Lavaine) – 7,5 / 10
Eine tolle kleine Komödie mit viel elegantem Wortwitz und lebendigen Charakteren. Das altbekannte Familienthema wird gleichermassen simpel wie charmant mit eingewoben.
The Hateful Eight (Quentin Tarantino) – 7,5 / 10
Tarantinos zweiter Westernversuch ist in Summe leider etwas zu lang geraten, trotzdem unterhält die derbe Mischung aus Krimipuzzle, Kammerspiel und Satire mit ihrem Wortwitz und den frechen Ideen. Lediglich von einem Teil des Ensembles hätte ich mir mehr erhofft.
Sully (Clint Eastwood) – 7 / 10
Charmanter, kleiner Geschichtsfilm, mal ganz ohne Pathos und aufs Wesentliche beschränkt. Ein auf seine Weise irgendwie sympathisches Spätwerk von Altmeister Clint.
Eight Days a Week (Ron Howard) – 7 / 10
Gut gemachte Doku über die Konzertjahre der Beatles; klug eingesetztes Archivmaterial, thematisch fokussierte Geschichtsaufarbeitung, für Fans sehenswert.
The Big Short (Adam McKay) – 7 / 10
Kurzweilige und vor allem stilistisch beachtlich eigensinnige Aufarbeitung der Finanzkrise. Nicht immer ganz ausgegoren, aber witzig und dennoch immer am Thema orientiert.
Bastille Day (James Watkins) – 7 / 10
Wendungsreiche Terroristenhatz durch die Strassen und über die Dächer von Paris. Eigentlich ein richtig guter Actionthriller, lediglich der mässige Figurenausbau fällt etwas negativ ins Gewicht.
Spotlight (Tom McCarthy) – 7 / 10
Solide und grösstenteils erfreulich nüchterne Themenaufarbeitung, starke Darsteller, spannende Dialoge. Guter Film, aber sicher nicht das vielzitierte Meisterwerk.
The Girl on the Train (Tate Taylor) – 7 / 10
Spannender Domestic-Noir-Thriller, der etwas Mühe hat, in die Gänge zu kommen, später dafür aber immer besser wird. Emily Blunt ist wie gewohnt alleine das Ticket wert.
War Dogs (Todd Phillips) – 6,5 / 10
Die grundlegenden Handlungsmuster dieses Waffenhändler-Dramas sind einem zur Genüge bekannt, spätestens seit Klassikern wie Goodfellas. Nichts Bahnbrechendes also, aber trotzdem launig umgesetzt und vor allem viel besser als befürchtet.
Deadpool (Tim Miller) – 6,5 / 10
Böse Superhelden Teil 1: Witzige und wüste Satire, die aber gerne noch eine ganze Ecke derber und verrückter hätte sein können und auch müssen.
Jack Reacher: Never go Back (Edward Zwick) – 6,5 / 10
Kompetente Adaption der Romane, bei der in erster Linie die rauen Actionszenen und der abgehalfterte Charme Spass machen. Auch hier gilt wieder: vor allem für Fans empfehlenswert.
Nerve (Ariel Schulman & Henry Joost) – 6 / 10
Spannende Grundidee, schwungvolle und unterhaltsame erste zwei Drittel, der Schlussakt geht aber eklatant in die Knie. Trotzdem irgendwie sympathisch und mal was anderes.
Trumbo (Jay Roach) – 6 / 10
Solides Biopic mit einem fantastischen Cranston und viel Zeitkolorit, aber der Handlungsfluss stolpert mitunter etwas vor sich hin.
The Magnificent Seven (Antoine Fuqua) – 6 / 10
Mässige Figuren, solide Inszenierung und ein fast schon erstaunlich starkes Finale. Das altbekannte 7er-Rezept macht halt immer wieder Spass, erreicht Kurosawas Original aber nicht im Ansatz.
Snowden (Oliver Stone) – 6 / 10
Stone ist zurück auf seinem polithistorischen Spezialgebiet und erzählt kurzweilig aber fragmentiert aus dem Nähkästchen der Geheimdienstkrise. Ein überzeugender Gordon-Levitt trägt die wechselhaften Episoden mühelos.
Jungle Book (Jon Favreau) – 6 / 10
Neuauflage des Disney-Klassikers, die vor allem mit ihren brillanten Effekten protzt. Weitgehend kurzweilig, aber auch nichts wirklich Neues.
Mechanic: Resurrection (Dennis Gansel) – 5,5 / 10
Jason Statham schlägt wieder zu. Neues wird einem in diesem Action-Best-of der letzten Jahre nicht geboten, in seinen inkohärenten Episoden ist es aber trotzdem einigermassen unterhaltsam.
X-Men: Apocalypse (Bryan Singer) – 5,5 / 10
Erschütternd inhaltsleerer und einfallsloser Nachklatsch der Reihe, der in erster Linie durch viel Nostalgie und eine Handvoll guter Szenen am Leben gehalten wird, dem ansonsten aber all die Besonderheiten abgehen, welche die Reihe einst ausgemacht haben.
Triple 9 (John Hillcoat) – 5,5 / 10
Schöne Atmosphäre und eine in den Ansätzen spannende Geschichte. Ansonsten aber ein durchschnittlicher Drogenkrimi mit verheiztem Starensemble.
Batman v Superman: Dawn of Justice (Zack Synder) – 5 / 10
Passable erste zwei Drittel und schwaches Schlussdrittel. Gute Grundidee, starker Affleck, pralle Action, aber in Summe einfach zu künstlich und zu überladen an Effektschlachten und Subplots, um wirklich zu zünden.
Doctor Strange (Scott Derrickson) – 5 / 10
Marvel-Kino nach der Strichliste. Selbst an den eigenen Massstäben gemessen erschreckend vorhersehbar und kaum originell, zum Einwegkonsum aber geeignet.
Inferno (Ron Howard) – 5 / 10
Auch die dritte Verfilmung von Dan Browns Spannungsromanen kann nicht ganz überzeugen, und das obwohl das erste Drittel noch richtig gut ist. Danach, spätestens aber in der zweiten Hälfte, fällt das dramaturgische Kartenhaus mehr und mehr in sich zusammen.
Deepwater Horizon (Peter Berg) – 4,5 / 10
Ein Katastrophenfilm der traumwandlerisch und mit bierernster Miene jedes Klischee bis zum Exzess ausschlachtet, dafür weiss die visuelle Umsetzung der Zerstörungsorgie zu beeindrucken.
Ben-Hur (Timur Bekmambetow) – 4,5 / 10
Guter Stoff, schlecht aufgekocht. Generisches Remake, das zum einmaligen Anschauen halbwegs taugt, darüber hinaus aber nichts Nennenswertes zu bieten hat.
Suicide Squad (David Ayer) – 4,5 / 10
Böse Superhelden Teil 2: Fängt stark an und lässt noch stärker nach. Ein angesichts des Stoffes erschütternd mutloser und handzahmer Action-Comedy-Quark mit ein paar guten Momenten.
Money Monster (Jodie Foster) – 4 / 10
Unentschlossener Mischmasch aus Thriller, Satire und Betroffenheitsdrama, funktioniert aber auf keinem dieser Gebiete so richtig. Clooney versucht zu retten, was es zu retten gibt.
Now you see me 2 (Jon M. Chu) – 4 / 10
Now you see me war vor drei Jahren ein überraschend flotter und spannender Mystery-Krimi, die Fortsetzung ist leider nichts davon. Vorhersehbare und platte Melange aus den verschiedensten Genre-Ingredienzen, dazu angesichts der gebotenen Handlung an Redundanz kaum mehr zu überbieten. Nur in Ansätzen leidlich unterhaltsam.
American Pastoral (Ewan McGregor) – 3,5 / 10
Sehr sperriges und bemühtes Drama, das völlig träge und theatralisch um seine geschichtlichen und familiären Motive herum aufgebaut ist und einem angesichts der guten Intentionen fast schon Leid tut. McGregor, bleib beim Schauspielern, denn das kannst du.
Joy (David O. Russell) – 3 / 10
Die nächste halbgar überdrehte Dramödie aus Russells Fliessbandschmiede. Unsinnig zusammengeschustertes Putzartikel-Werbefilmchen mit viel theatralischer Freakshow und zielloser Geschichte. Jennifer Lawrence ist schlicht lächerlich.
Meine unbestreitbaren Highlights dieses Jahr waren aber ohne Zweifel die Entdeckung eines neuen, wunderbar ausgestatten Programmkinos in der Nähe und damit einhergehend der Genuss einiger schöner Klassiker im Rahmen von Programmreihen und Retrospektiven. Innert weniger Monate drei der für mich besten Filme aller Zeiten auf der Leinwand zu erleben kommt nicht gerade häufig vor. Leider habe ich in diesem Sektor auch vieles verpasst.
C’era una Volta il West (1968, Sergio Leone) – 10 / 10
Vermutlich der beste Film aller Zeiten, eine elegische Sinfonie aus Bildern und Musik, die durch Mark und Bein geht. Die Essenz filmischer und emotionaler Faszination in zweieinhalb Stunden komprimiert, eine Erfahrung, die nicht mehr von dieser Welt ist.
Taxi Driver (1976, Martin Scorsese) – 10 / 10
Immer noch die spannendste, schönste, brutalste und erschütterndste Charakterstudie aller Zeiten. De Niros Verkörperung seiner komplexen und zerrissenen Rolle ist übermenschlich, Herrmann beendet sein meisterhaftes Lebenswerk mit wehmütigen Saxofonklängen und Scorsese veredelt sein radikales Psychogramm der Vietnamgeneration mit Bildern und Szenen, die man so schnell nicht vergisst.
Psycho (1960, Alfred Hitchcock) – 10 / 10
Die nächste hervorragende Charakterstudie: Ein derber, verstörender und faszinierender Horrorschocker, dessen innere Spannung schier implodiert, und dem Herrmanns prägnanter Jahrhundert-Soundtrack die Krone aufsetzt. Hitchcocks bester, und das will was heissen.
Lost Highway (1997, David Lynch) – 9,5 / 10
Der Meister des surrealen Kinos in seinem Element: Ein irrwitziger audiovisueller Trip durch einen Thriller voll mit wechselnden Identitäten, unerklärlichen Horror-Einschüben und morbiden Albtraumsequenzen. Kommt im Kinosaal noch um Einiges beeindruckender rüber als zu Hause.
Dead Man (1995, Jim Jarmusch) – 9,5 / 10
Jarmuschs Meisterstück; eine psychedelische Odyssee durch die Wälder Nordamerikas, die einen völlig neuen Blick auf das Westerngenre wirft. Neil Youngs unkonventionelle musikalische Untermalung setzt dem Ganzen die Krone auf.
Det Sjunde Inseglet (1957, Ingmar Bergman) – 9 / 10
Max von Sydow spielt Schach mit dem Sensenmann: Noch eine psychedelische Odyssee, dieses Mal durch das pestverseuchte mittelalterliche Schweden. Sehr spannend und cineastisch innovativ.
Only Lovers Left Alive (2013, Jim Jarmusch) – 8,5 / 10
Der erfrischend andere Vampirfilm, geistreich, sinnlich, witzig und phänomenal gespielt. Die Verbindung aus Bildsprache und erneut sehr unkonventioneller Filmmusik ist das Tüpfelchen auf dem i.
Night on Earth (1991, Jim Jarmusch) – 7,5 / 10
Jarmusch zum Dritten: Sehr schöner Episodenfilm der sich aus verschiedenen Kurzfilmen zusammensetzt, die alle in einem Taxi spielen. Eine unterhaltsame Reise durch fünf völlig verschiedene Städte, aber wie das bei Episodenfilmen häufig der Fall ist, sind einige der Geschichten einfach deutlich besser als andere.
Il Deserto Rosso (1964, Michelangelo Antonioni) – 6,5 / 10
Filmisch interessanter Blick auf die Vereinsamung einer Seele, die ich aber emotional nicht völlig verstanden habe. Einzelne Szenen sind exzellent, andere bleiben mir zu distanziert.
Shutter Island (2010, Martin Scorsese) – 6 / 10
Scorseses schwächster Film, als Psychothriller und auch als Charakterstudie deutlich zu plump und gewöhnlich aufgebaut. Viele Ansätze und Szenen wissen aber zu gefallen, und die erste Hälfte ist noch sehr vielversprechend.
Und zum Abschluss noch eine Auswahl sehr guter bis exzellenter Filme, die ich dieses Jahre zu Hause zum ersten Mal gesehen habe:
Rashōmon (Akira Kurosawa 1950)
Singin‘ in the Rain (Gene Kelly 1952)
Ikiru (Akira Kurosawa 1952)
Breakfast at Tiffany’s (Blake Edwards 1961)
Repulsion (Roman Polanski 1965)
Star Trek: The Undiscovered Country (Nicholas Meyer 1991)
La Double Vie de Véronique (Krzysztof Kiéslowski 1991)
Bleu (Krzysztof Kiéslowski 1993)
Rouge (Krzysztof Kiéslowski 1994)
Across the Universe (Julie Taymor 2007)
Scott Pilgrim vs. The World (Edgar Wright 2010)